3. Adventssonntag 15. 12. 2024
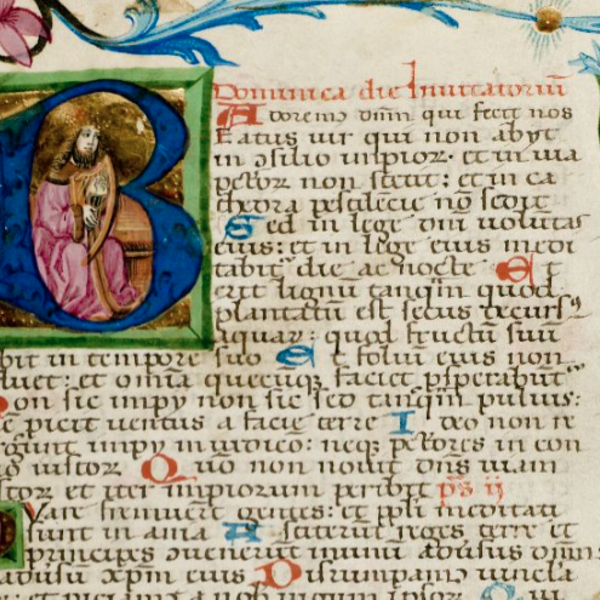
Der Text ist bekannt von dem berühmten Adventslied „Tochter Zion“. Die Musik stammt von Georg Friedrich Händel. Zunächst in einem Londoner Opernhaus erklungen, dann in einem Wiener Palais von Beethoven weitergeführt, schließlich in einem bürgerlicher Salon in Erlangen gesungen. Das Advent- oder Weihnachtslied hat bereits einen langen Weg zurückgelegt, bis es Einzug in die Gottesdienste fand. Es passt zum 3. Adventssonntag "Gaudete". (GL 228) – und generell für traurige Menschen und in dunkler Zeit. https://www.katholisch.de/artikel/23886-dritter-advent-tochter-zion-freue-dich
Der Prophet Zefanja prangerte im 7. Jh. v. Chr. religiöse, soziale und politische Missstände an und weissagte seinem Volk Unheil und das Gericht Gottes. Aber er versprach auch einen Neuanfang für einen „Rest von Israel“, der nicht mehr auf Reichtum und kriegerische Macht baut, sondern in Frieden und Mitmenschlichkeit auf Gott vertraut. Auf diese Botschaft folgt der heutige Lesungstext. In einem Jubellied wird die Rettung der „Tochter Zion“ besungen. Mit „Tochter Zion“ ist das Volk Israel gemeint.
Evangelium: Lk 3,10-18
10 In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer:
Was sollen wir also tun?
11 Er antwortete ihnen:
Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat,
und wer zu essen hat, der handle ebenso!
12 Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, (…)
Johannes der Täufer steht wie Hanna (Lk 2,36-38) in der Reihe der prophetischen Menschen. Das zeigt deutlich, dass das Neue Testament an das Alte Testament anschließt. Die Hoffnungen auf eine Zeit der Gotteserkenntnis und der Gerechtigkeit für alle, das ist der große Traum Israels. Das ist die Verkündigung der Prophetie. Neben der Hoffnung spricht die Prophetie auch in drastischen Bildern vom Gericht, das notwendig ist, damit die neue Zeit anbrechen kann. Die wichtigste Frage, nachdem Johannes in Lk 3,1-6 die Möglichkeit der Umkehr aufgezeigt hat, ist nun: Wie kann das gehen? Wie sollen wir leben? Was sollen wir tun? Die Antworten des Täufers in Lk 3,10-14 sind sehr pragmatisch. Sie verlangen nichts Unmögliches. Sie sind in gewisser Weise sogar leicht. Teilen, wenn man mehr hat, als man braucht. Sich an die gesetzlichen Regeln halten und niemanden über den Tisch ziehen. Die eigene Macht nicht missbrauchen. Die unausgesprochene Frage, ob Johannes selbst der Christus ist, verneint Johannes. Er verweist auf einen Stärkeren. Er bezeichnet sich als sein Sklave. Ein klassisches biblisch-prophetisches Gerichtsbild wird hier verwendet. Die neue Zeit und die neue Gerechtigkeit kann nicht entstehen, wenn die Spreu (vgl. Ps 1,4), sprich Sünde und Frevel, Bestand hat.
Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.
Der Evangelist Lukas bewertet in V. 18 die Predigt des Johannes in zweierlei Hinsicht: Er nennt sie „Ermahnung“, im Sinne von drastischem Aufruf zur Änderung. Gleichzeitig nennt er sie auch „frohe Botschaft“ – eben „Evangelium“. Vielleicht ist das ein Aspekt in der Person des Täufers, den wir neu hören lernen sollten: Es geht nicht nur um Gerichtspredigt. Das Ziel des Gerichtes ist das neue Leben im Angesicht Gottes. Nicht nur die Predigt vom Gericht, sondern mindestens auch seine Predigt von der „neuen Welt“, seine Ideen und seine Phantasie haben die Menschen in Scharen an den Jordan gelockt.
Nur so wird Predigt zur Guten Nachricht.